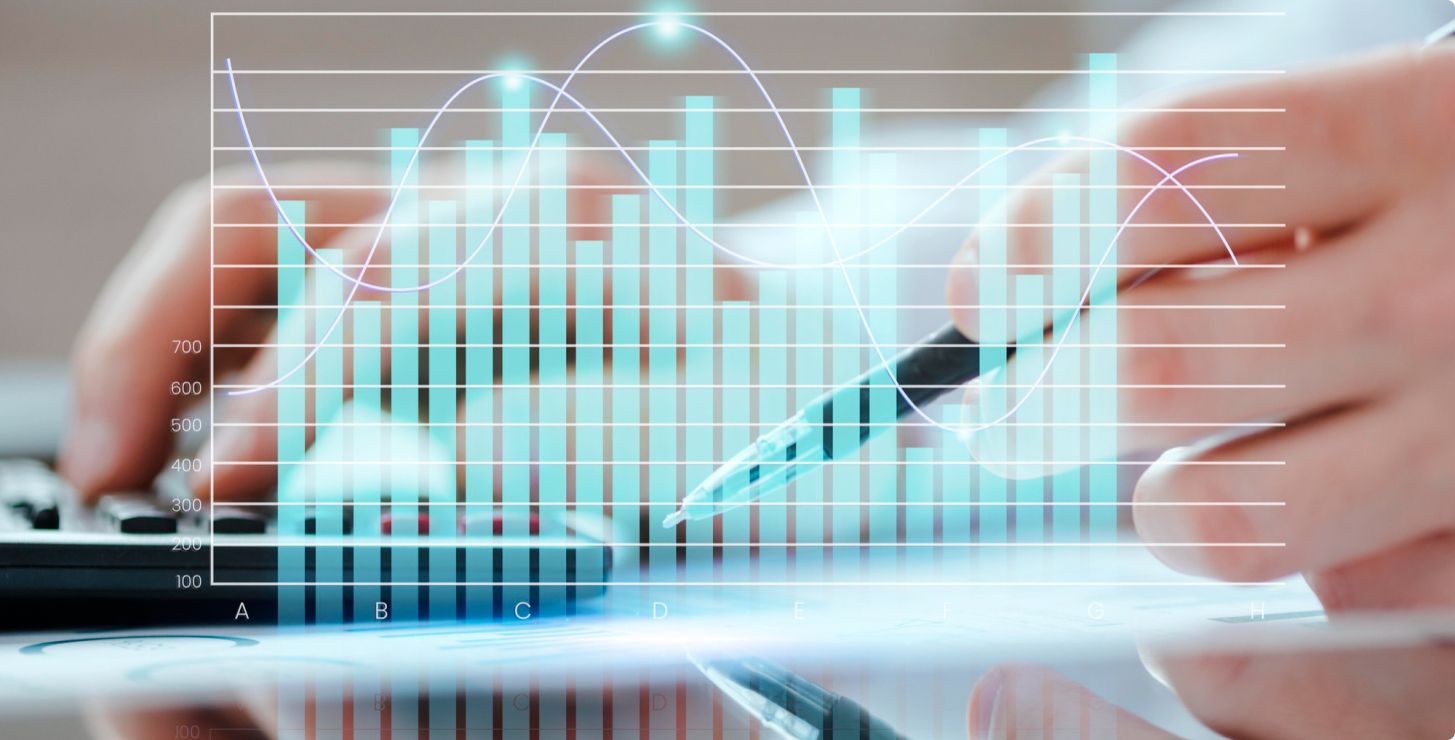Öl und Kanonen. Warum neue Militärausgaben die europäische Wirtschaft nicht ankurbeln werden.

Alexander Lubniewski
Mar 10, 2025Letzte Woche kündigten Deutschland und die EU die Einrichtung von Fonds in Höhe von Hunderten Milliarden Euro an, die größtenteils für Militärausgaben verwendet werden sollen. Wir erklären, wie es derzeit um die Staatsfinanzen in den europäischen Ländern steht und ob die Militarisierung der Wirtschaft einen wesentlichen Impuls geben kann.
Warum europäische Anleihen stark gefallen sind
Letzte Woche erlebte der EU-Anleihenmarkt einen äußerst empfindlichen Ausverkauf: Am 5. und 6. März 2025 stiegen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen von Deutschland, Frankreich und Italien, den größten Volkswirtschaften Europas, innerhalb von zwei Tagen um etwa 40 Basispunkte. Am Mittwoch erlebte die deutsche Staatsverschuldung den schlechtesten Tag seit dem Fall der Berliner Mauer: Die Rendite von Langläufern stieg um 30 Basispunkte auf 2,85 %.
Der so starke Preisrückgang bei Anleihen zeigte die nervöse Reaktion der Investoren auf die Entscheidung Deutschlands, die strengen Haushaltsregeln zu lockern und Militär- und Infrastrukturausgaben vom „Schuldenbremsen“ zu befreien. Auch auf den neuen ehrgeizigen Plan zur Wiederaufrüstung der Europäischen Union ReArm Europe, der am 4. März von der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen vorgestellt wurde.
Laut dem Programm wird vorgeschlagen, bis zu 800 Milliarden Euro zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten der EU und zur dringenden Unterstützung der Ukraine bereitzustellen, die ohne amerikanische Hilfe geblieben ist. „Wenn die EU-Länder die Verteidigungsausgaben im Durchschnitt um 1,5 % des BIP erhöhen, wird dies ein zusätzliches Budget von 650 Milliarden Euro über vier Jahre schaffen“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission. Weitere 150 Milliarden Euro wurden vorgeschlagen, in Form von EU-Krediten bereitzustellen und für den Kauf von Luftverteidigungssystemen, Artillerie, Munition und Drohnen zu verwenden.
Die Notwendigkeit, die Militärausgaben in der EU zu erhöhen, hängt auch damit zusammen, dass die USA und insbesondere Donald Trump die Europäische Union seit langem für die jahrelange Nichterfüllung der NATO-Verpflichtung kritisieren, mindestens 2 % des BIP für die Verteidigung auszugeben. Bereits 2024 erklärte Trump in einer Ansprache an die EU-Staats- und Regierungschefs: erklärte: „Nein, ich würde euch nicht verteidigen. Mehr noch, ich würde sie (die Russen) ermutigen, alles zu tun, was sie wollen. Ihr müsst zahlen. Ihr müsst eure Rechnungen bezahlen.“ Im Januar 2025 drohte der US-Präsident sogar, die Anforderung der Verteidigungsausgaben der NATO-Mitglieder auf 5 % des BIP zu erhöhen.
Die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder stimmten auf dem EU-Gipfel am 6. März in Brüssel für die Annahme des Plans zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben. „Was auch immer in der Ukraine passiert, wir müssen autonome Verteidigungskapazitäten in Europa aufbauen“, betonte der französische Präsident Emmanuel Macron nach dem Gipfel.
Wie die EU-Länder auf Kredit leben
Die Reaktion der Schuldenmärkte auf die Ankündigung neuer Ausgaben hängt damit zusammen, dass Investoren ein Wachstum des Haushaltsdefizits der europäischen Länder befürchten. Laut dem 1992 unterzeichneten Maastricht-Vertrag darf die Staatsverschuldung in den EU-Ländern 60 % des BIP nicht überschreiten und das Haushaltsdefizit nicht mehr als 3 % des BIP betragen. In der Praxis wurden diese Regeln ständig durch politisch getroffene Entscheidungen verletzt, unter anderem um den Folgen globaler Krisen, Pandemien usw. entgegenzuwirken.
Angesichts einer Reihe von Krisen (zuerst die Pandemie, dann die Energiekrise und die Notwendigkeit, die Militärlieferungen zu erhöhen) hat die EU die Haushaltsbeschränkungen erheblich gelockert. Im März 2020 wurde die allgemeine Fluchtklausel aktiviert – eine allgemeine Klausel, die es vorübergehend ermöglicht, die Defizit- und Schuldenbeschränkungen nicht einzuhalten. Diese Maßnahme blieb bis Ende 2023 in Kraft und gab den Ländern die Freiheit, die Kreditaufnahme zur Unterstützung der Wirtschaft zu erhöhen.
Infolgedessen stiegen die Haushaltsdefizite: Das durchschnittliche Defizit in der Eurozone erreichte im Pandemie-Jahr 2020 7 % des BIP und blieb 2021–2022 über 3–4 % des BIP. Zum Vergleich: In den Vorkrisenjahren überschritt das Haushaltsdefizit in den Euro-Ländern normalerweise nicht 1 % des BIP, und einige Länder, wie Deutschland, hatten einen Überschuss. Eine ganze Reihe von Ländern beendete das Jahr 2023 mit Defiziten, die deutlich über 3 % lagen. So betrug es in Italien 7,2 % des BIP, in Frankreich 4,7–4,9 %, in Spanien 4 %, in Ungarn 6,7 %, in Rumänien 6,5 %.
Das Wachstum der Defizite hängt damit zusammen, dass die Staatsausgaben erheblich gestiegen sind. Laut Eurostat hielten sich die gesamten Staatsausgaben der Eurozone in den Jahren 2022–2023 auf einem Niveau von 49–50 % des BIP, während dieser Indikator im Vorkrisenzeitraum (2013–2019) allmählich auf 46 % des BIP sank. Somit „verteilt“ die Regierung jetzt fast die Hälfte des gesamten BIP um – das liegt über dem langfristigen Trend. Der Grund sind die umfangreichen Antikrisenmaßnahmen: In den Jahren 2020–2021 finanzierten die Behörden Programme zur Unterstützung von Unternehmen und Bevölkerung (Lockdowns, Medizin, Impfstoffe), und im Jahr 2022 – Kompensationen aufgrund des Anstiegs der Energiepreise infolge der Reduzierung der Lieferungen aus Russland.
Darüber hinaus wurde der zu diesem Zeitpunkt beispiellose gesamteuropäische Wiederaufbaufonds NextGenerationEU in Höhe von 750 Milliarden Euro gestartet, der es den Ländern ermöglichte, zusätzliche Ressourcen für Investitionen in Höhe von 5–6 % des BIP der EU zu mobilisieren. All dies hat die Haushaltsbeschränkungen vorübergehend erweitert – Schulden, die zuvor als bedrohlich galten, wurden akzeptabel. Zum Beispiel nahm Deutschland im Jahr 2022 200 Milliarden Euro neue Schulden auf, die Hälfte davon für den Verteidigungssonderfonds und kriegsbedingte Ausgaben. Dies verdoppelte faktisch das ursprünglich geplante Kreditvolumen für das Jahr. Dieser Anstieg war eine Ausnahme von der deutschen „Schuldenbremse“ und zeigte, dass selbst die fiskalisch konservativsten Länder bereit sind, vorübergehend die bisherigen Beschränkungen zugunsten außergewöhnlicher Ausgaben zu überschreiten.
.png)
Es sollte nicht überraschen, dass infolge aller Stimulierungsmaßnahmen der staatliche Schuldenstand der EU-Länder zum Ende des dritten Quartals 2024 81,5 % des BIP erreichte, was deutlich über der 60 %-Grenze der Maastricht-Verträge liegt und über dem Vorkrisenniveau (etwa 79 % des BIP im Jahr 2019) bleibt. Allerdings unterscheidet sich die Situation erheblich zwischen den Mitgliedsländern: Das traditionell disziplinierte Deutschland hält die Schuldenquote bei 62 % des BIP, während Frankreich (112 %), Italien (135 %) und Spanien (108 %) eine deutlich höhere Schuldenlast haben. Besonders hervorzuheben ist Griechenland, dessen Schuldenstand mit 158 % des BIP der höchste in der EU bleibt, obwohl dies deutlich unter dem Höchstwert von 207 % liegt, der im Jahr 2020 erreicht wurde. Nach der Umschuldung im Jahr 2011 sind die Kreditbedingungen Griechenlands wesentlich günstiger als die Italiens, das seine Kredite ständig zu Marktbedingungen refinanzieren muss. Die Schlüsselfrage bleibt, wie die größten Volkswirtschaften der EU beabsichtigen, das Niveau der Staatsverschuldung in Zukunft zu senken, angesichts neuer Verteidigungsausgaben, ohne weitere Defizitsteigerungen und Erhöhungen der Finanzierungskosten zu provozieren.
Warum Militärausgaben für die Wirtschaft ineffizient sind
Mit der Lockerung der „Schuldenbremse“ in Deutschland waren die Haupthoffnungen der Investoren auf das Wirtschaftswachstum des Landes im Vorfeld der Arbeit des neuen Parlaments verbunden. Tatsächlich haben steigende staatliche Verteidigungsausgaben kurzfristig eine stimulierende Wirkung auf die Wirtschaft. Regierungskäufe von Waffen, militärische Infrastruktur und die Gehälter der Beschäftigten im Verteidigungskomplex erhöhen direkt die Gesamtnachfrage. Somit tragen zusätzliche Verteidigungsausgaben kurzfristig zum BIP-Wachstum bei, dank des Multiplikatoreffekts der Staatsausgaben. Ökonomen bewerten den Multiplikator der Militärausgaben auf etwa 0,5–0,7, das heißt, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 1 % des BIP kann das BIP um etwa 0,5–0,7 % über mehrere Jahre erhöhen. Dieser Impuls ist jedoch hauptsächlich einmalig und wird wahrscheinlich nachlassen, sobald die Ausgaben auf einem neuen Niveau stabilisiert sind.
Mittelfristig und langfristig birgt die Erhöhung der Militärbudgets Risiken für nachhaltiges Wachstum. Der Hauptunterschied bei den Verteidigungsausgaben besteht darin, dass sie keine unmittelbare Rendite in Form einer Steigerung der Produktivität der Wirtschaft bieten, es sei denn, es gibt einen großen Überschuss an Arbeitskräften und freien Produktionskapazitäten, wie in den USA vor dem Zweiten Weltkrieg. Mittel, die für Panzer, Flugzeuge und Munition ausgegeben werden, schaffen kein neues Einkommen oder Infrastruktur, die das Wachstumspotenzial des BIP erhöhen würde. Im Gegensatz zu Investitionen in Bildung, Verkehr oder Technologie generieren militärische Einkäufe keinen zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen (ihr „Nutzen“ ist Sicherheit, die schwer in BIP zu messen ist).
Laut einigen Studien kann eine Erhöhung der Militärausgaben um 1 % des BIP zu einer Verlangsamung des Wachstums um insgesamt bis zu 9 Prozentpunkte über 20 Jahre führen. Der Grund ist der Verdrängungseffekt: Ressourcen (Kapital, Arbeit), die in der Verteidigung eingesetzt werden, werden aus den produktivsten Sektoren abgezogen. Die Regierung muss entweder die Steuern erhöhen oder die Kreditaufnahme erhöhen, um das Militär zu finanzieren. Steuererhöhungen verringern private Investitionen, und steigende Schulden erhöhen die Kosten für die Bedienung und die Risikoprämien für Investitionen. Darüber hinaus führt eine hohe militärische Belastung bei sonst gleichen Bedingungen dazu, dass in der Wirtschaft die Akkumulation von Sachkapital – langfristigen Vermögenswerten, die die Grundlage der Wirtschaft bilden – abnimmt. Dazu gehören Produktionskapazitäten, Verkehrs- und Energieinfrastruktur, High-Tech-Ausrüstung sowie intellektuelles Kapital, einschließlich Investitionen in Wissenschaft und Bildung. Die RAND-Studie zeigt: Die Priorität der Verteidigungsausgaben auf Kosten der Kürzung von Investitionen in die Infrastruktur „untergräbt das Wirtschaftswachstum und damit die für die Verteidigung in der Zukunft verfügbaren Ressourcen“. Somit kann eine übermäßig hohe Militarisierung der Wirtschaft ihre fundamentalen Grundlagen – Technologie und Kapital, einschließlich des menschlichen Kapitals – schwächen.